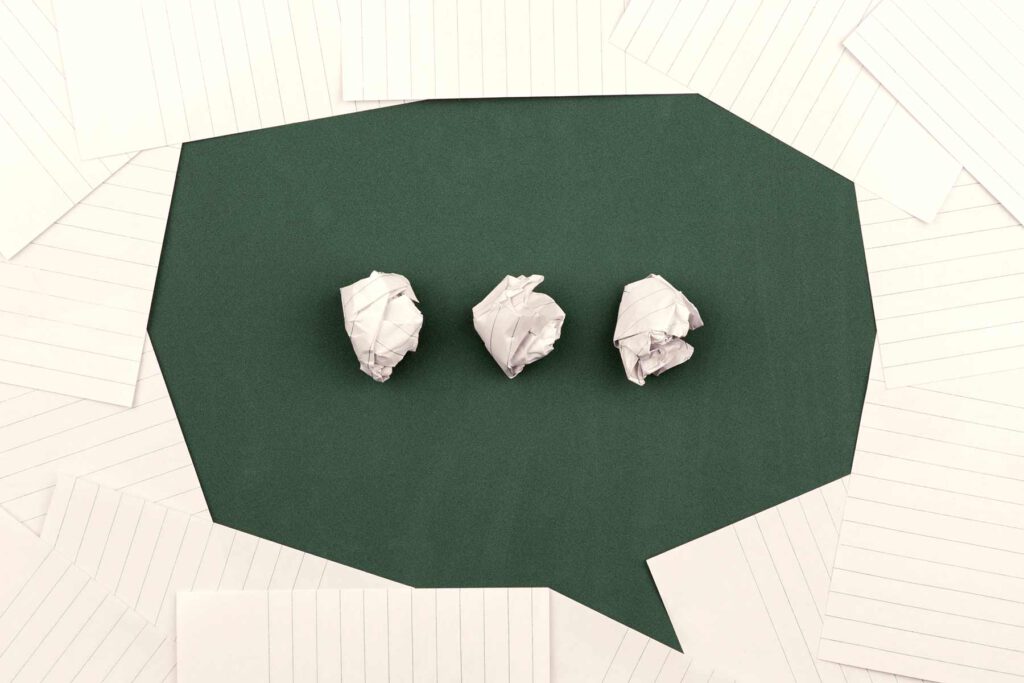Gartentherapie

Gartentherapie ist nach Pfister (2010) „ein von einer Gartentherapeutin oder einem Gartentherapeuten gesteuerter Prozess, in welchem Pflanzen und Gartenaktivitäten dazu verwendet werden, das soziale, psychische und körperliche Wohlbefinden von Menschen zu stärken.“ Gartentherapie wirkt also ganzheitlich, begleitend und unterstützend, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu fördern und ist für viele Zielgruppen geeignet.
Wie wirkt Gartentherapie?
In der Natur stellt der menschliche Körper eine Verbindung mit ihr her. Forschungsergebnisse zeigen, dass Blutdruck, Herzfrequenz, Muskelspannung und das Niveau der Stresshormone schneller abnehmen. Kurz, R. (2008) sagt: „dass der Garten als Therapiemittel bzw. als therapeutische Umgebung eine heilsame Wirkung auf Patienten ausübt. Es wird sichtbar, dass Patienten im Freien aufblühen, sich emotional öffnen, motorisch hohe Leistungen vollbringen, ruhiger und kognitiv orientierter werden“. Die Grundvoraussetzung ist, dass der Klient ein Bezug zu Pflanzen und Natur hat.
In meinem Ansatz ist die Natur, ist der Garten Co-Therapeut. Durch das Tun und Erleben und Wahrnehmen durch alle Sinne wird der therapeutische Prozess angeregt und vermittelt. Es besteht eine weniger formale Beziehung in dem das Gespräch entspannter im Hier und Jetzt stattfinden kann. Die Erfahrungen die gemacht werden in der Natur, können eine tiefere Wirksamkeit und Verständnis herbeiführen und ermöglichen in diesem Setting eine ebenbürtige Begegnung auch zwischen Therapeutin und Klient. Neue Fertigkeiten werden gelernt, Selbstvertrauen und Selbstachtung werden gestärkt, es gibt Raum für Kreativität und Freude. Soziale Fertigkeiten werden geübt und durch ganzkörperliche Beanspruchung wird die Bewegungsfähigkeit und Ausdauer gestärkt.
Resilienz Coaching

Resilienz ist ein Begriff der mit Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit und Flexibilität umschrieben werden kann. In jedem Menschen ist Resilienz unterschiedlich ausgeprägt. Aber es kann aktiv angestoßen und gestärkt werden so dass eine weiterführende Entwicklung zum Wachsen hin geschehen kann.
Als Resilienz Coach nutzt die Therapeutin die Methode des Human Balance Training (HBT) nach Sylvia Kéré Wellensiek. Es ist eine ganzheitliche Arbeitsmethode, mit systemischem Blick, die den Menschen in seinem ganzen Wesen von Körper, Gefühl, Verstand und Seele anspricht. Verschiedene Arbeitsansätze werden zusammengeführt und im Training verwandt. Es wird geschaut was Widerstandskraft gibt, was Belastungsfähigkeit und Flexibilität steigert und was die Energie raubt und wie aktiv Entlastung und Verbesserung herbeigeführt werden kann. Oft lösen kritische Lebensereignisse in uns Hilflosigkeit und Ohnmacht aus und führen zu einem Verlust der Handlungsorientierung. In meinem Ansatz wird daran gearbeitet diese Handlungsorientierung wiederherzustellen. Klar definierte Arbeitsstufen unter Einbeziehung der Natur helfen diese Verflechtungen bewusst zu machen und achtsam und zielführend zu bearbeiten.
Ergotherapie

Der deutsche Verband der Ergotherapeuten (DVE, 2007) definiert die Ergotherapie wie folgt: „Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen.“
Oft werden Menschen nach einer akuten Erkrankung nach Hause entlassen aber die Reintegration ins normale Leben wird nicht erfolgreich gemeistert, bzw. begleitet. Hierin liegt mein Ansatz: Beratung und Begleitung, um diese Handlungsfähigkeit zu stärken, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern, bzw. verbessern.
In Verbindung mit meinem gartentherapeutischen Ansatz arbeite ich u. a. nach dem MOHO Konzept (Model of Human Occupation) nach Kielhofner (2002), dem bio-psychosozialen Modell der ICF und dem Canadian Occupational Performance Measure (COPM) als ein individualisiertes Messinstrument, um Veränderungen der Betätigungsperformanz aus Sicht des Klienten zu erkennen.